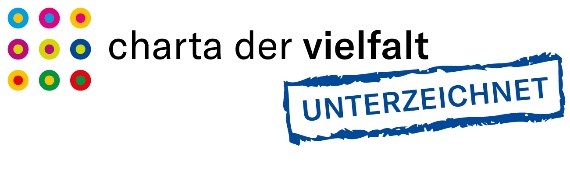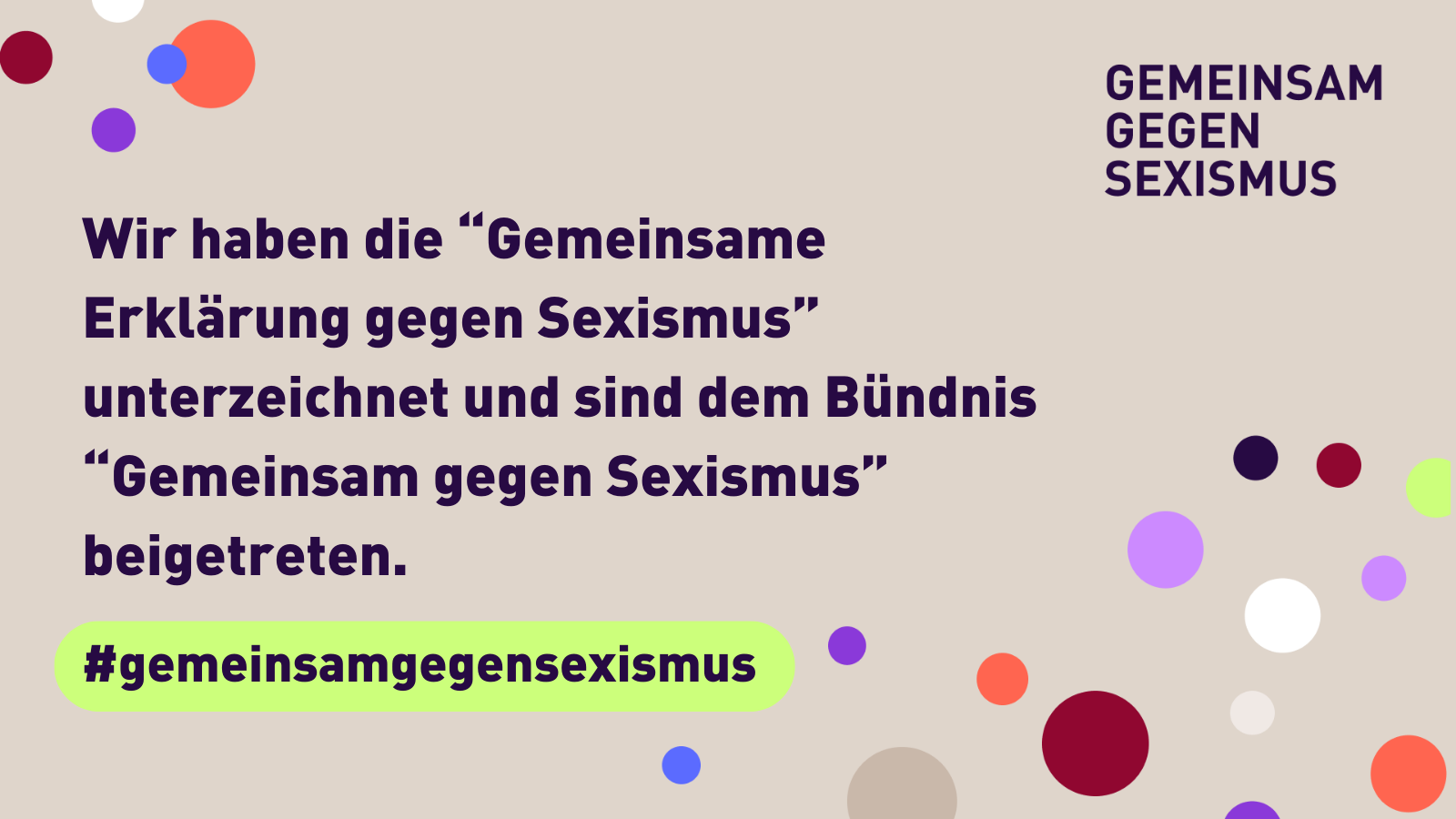Ehrliche Voreingenommenheit

Alle Menschen haben Vorurteile. Wir erlernen diese durch Vor-Erfahrungen, die wir mit Menschen machen und den Gefühlen, die wir dabei haben. Oder weil wir die Erfahrungen von anderen Menschen einfach übernehmen. Wenn uns z.B. jemand etwas über andere Menschen erzählt oder wir Nachrichten lesen. Unsere Vorurteile führen dazu, dass wir uns ein Urteil über einen Menschen bilden, bevor wir die Person näher kennenlernen.
Wir brauchen unsere Vorurteile. Sie ermöglichen uns Handlungsfähigkeit im Alltag. Sie können aber auch falsch sein. Sie können dazu führen, dass wir z.B. jemanden direkt mögen. Oder vor jemandem Angst haben. Sie beeinflussen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und andere Menschen mit uns. Oft merken wir es gar nicht. Denn unsere Vorurteile können unbewusst sein. Unbewusste Vorurteile können im Widerspruch zu unseren bewussten Werten und Einstellungen stehen.
Vielleicht hatten wir mal einen gemeinen Streit mit einem blonden Kind mit Sommersprossen. Jetzt denken wir, dass alle blonden Menschen mit Sommersprossen gerne streiten. Das wäre unser Vorurteil. Wir merken nicht, dass die allermeisten Menschen mit blonden Haaren und Sommersprossen genauso wenig gerne streiten wie wir. Das können wir nur Herausfinden, wenn wir uns mit anderen blonden Menschen mit Sommersprossen unterhalten oder sogar anfreunden. Vorurteile können dazu führen, dass wir unter Umständen eine Menge verpassen.
Vorurteile gibt es oft, wenn wir etwas nicht genau kennen oder verstehen können. Ein Beispiel kann ein neuer Nachbar im Haus sein. Vielleicht sieht dieser Mensch für uns fremd aus. Und auch andere berichten uns, dass der komisch ist. In Wirklichkeit ist das vielleicht ein ganz netter Mensch und man kann sehr viel Spaß zusammen haben. Es lohnt sich in diesem Fall also erst einmal miteinander zu Kommunizieren und sich eine eigene Meinung zu bilden.
Jeder Mensch kann sich seine eigenen Vorurteile und ihre Folgen bewusst machen. Wir können uns vornehmen ein Vorurteil zu ändern. Dafür suchen wir aktiv Informationen und Perspektiven, welche die eigenen herausfordern. So können wir lernen offener auf andere Menschen zuzugehen. So können wir Gemeinsamkeiten entdecken und Unterschiede wertschätzen. Das ist gut für alle Menschen.
Fragen um das Vorurteilsbewusstsein (weiter) zu entwickeln
- Es ist einfacher Vorurteile bei anderen zu entdecken – vielleicht habe ich ähnliche?
- Berücksichtigen Sie: Welche Faktoren beeinflussen Entscheidungen.
- Wie reagiere ich auf unterschiedliche Menschen? Habe ich eine Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Gruppen?
- Versuche ich mich in Gesprächen in die Lage der anderen zu versetzen?
- Erkennen Deine Privilegien: Wann werde ich bevorzugt (behandelt)? Wie geht es Menschen, die benachteiligt werden?
- Spiegeln meine Worte und Handlungen meine Absichten?
Wissenswertes zum Thema Müll und Vielfalt
Sich neues Wissen aneignen. Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten. Auch das reduziert Ausgrenzung und Benachteiligung.
Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Müll denken? Meist nichts Angenehmes. Müll beschäftigt uns. Dabei gibt es diesen Begriff, wie wir ihn heute verwenden, für Dinge, die für uns nicht mehr brauchbar sind, noch nicht so lange. Vor über 100 Jahren hatte jeder Beruf eine eigene Bezeichnung für nicht verwendbare Überbleibsel der Arbeit. Metzger nannten es „das Kleine“ und Müller nannten es „Müll“ – das, was beim Mahlen des Mehls unverwertbar übrigblieb. Letzteres setzte sich durch. Zunächst war es eine neutrale Bezeichnung, für etwas, dass nicht mehr verwendet werden kann. Heute verbinden wir damit meist unangenehmes. Er kann uns ärgern. Insbesondere, wenn er irgendwo sichtbar liegt. Müll sieht nicht schön aus. Und er kann stinken. Offene Nahrungsreste ziehen Ratten an, Fliegen und Mücken schwirren im Sommer dort herum.
Das Schrottauto ist für Autobesitzer:innen nichts mehr wert, für Schrotthändler:innen dagegen schon. Nicht alle Menschen unterscheiden zwischen Gut und Müll (als etwas Schlechtem). Manchmal wird alles weiterverwertet. In einer Wegwerfgesellschaft wie der unseren, denken wir bei Müll an entsorgen. Daran, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen (um den Müll als Gefahr). Müll soll in den Mülleimer. Müll kommt in den Container. Aus den Augen, aus dem Sinn. Etwas wird weggepackt und ist weg. Aus dem Sichtfeld heraus. Wenn er dort doch wieder auftaucht, ärgert er uns umso mehr. Macht uns vielleicht sogar wieder Angst – vor Unreinheit, vor Viren oder Ratten. Müll aus Deutschland ein Exportschlager. Müll ist auch Geschäft. Müll hat einen Wert, ähnlich wie Geld, wenn auch negativ.
Müll ist divers. Nicht nur in seiner Zusammensetzung. Nicht nur in seiner Verwendung. Auch in seinem Wesen. So lassen einerseits Männer Müll eher liegen als Frauen. Männer verursachen aber auch mehr Müll.[1] Andererseits arbeiten im Müllsektor viele Frauen, besonders in den Ländern, in denen auch unser Müll verarbeitet wird. Diese Frauen erleben neben Armut und gesellschaftlicher Ausgrenzung auch häufig innerhalb des Sektors Diskriminierung. So haben Frauen insbesondere im informellen Bereich beispielsweise erschwerten Zugang zu hochwertigem recycelbarem Müll, sie werden schlechter bezahlt als Männer und haben weniger Chancen, höhere Positionen im Müllmanagement zu bekleiden.[2]
Wer Müll richtig entsorgt, zeigt Klasse. Denn dadurch kann dieser noch verwertet werden und beeinträchtigt unser Wohlbefinden nicht. Aber auch der Müll selbst zeigt Klasse. Seine Zusammensetzung zeigt welche soziale Schicht Konsument:innen haben. Sie bildet sich im Müll ab und dieser gibt Auskunft über Bedürfnisse und Gewohnheiten gewisser gesellschaftlicher Schichten.[3] Auch in der Geschichte finden wir die Unterscheidung zwischen etwas wertlosem (Müll) und etwas mit Wert – manche werfen etwas in den Müll, andere holen es zur Verwendung wieder heraus. Auch das hing und hängt mit Klasse zusammen.
Wird Müll bewusst auf den Boden geworfen oder liegengelassen hängt vor allem davon ab, ob andere Menschen anwesend sind und Mensch sich beobachtet fühlt. Ist kein Mülleimer in der Nähe, gewinnt dann oft die Faulheit. Wieder landet der Müll auf dem Boden oder im Gebüsch. Liegt bereits Müll an einem Ort, zeigen Menschen mehr Bereitschaft ihren eigenen Müll auch dort liegen zu lassen. Müll zieht Müll an. Kommen noch weitere Elemente hinzu wie Graffiti an den Wänden oder „zerbrochene Fensterscheiben“ entsteht der Eindruck mangelnder Kontrolle und die Nichteinhaltung von Normen. Eine Kettenreaktion wird ausgelöst, die auch zu Diebstählen führen kann. Müll entsprechend zu entsorgen ist für das eigene Wohlbefinden gut und das Gemeinwohl sinnvoll.
Der Umgang mit Müll ist Gewohnheit. Und Gewohnheiten lassen sich ändern. Mensch muss es allerdings wollen, sich vornehmen und immer wieder üben. Habe ich heute schon meinen Müll entsorgt? Ein kleiner Schritt für mich. Ein großer Schritt für die Gemeinschaft.
„Wir sehen den Müll natürlich jeden Tag, aber wir sind abgestumpft, wir blenden das aus. Wenn wir uns bücken müssen, um ihn aufzuheben, dann merken wir, wie irre viel das ist, dann wird die Sensibilität dafür geschärft.“
(Meeresbiologe Lars Gutow)
Müll bezeichnet in jüngerer Zeit allerdings auch geistige und virtuelle Inhalte, die als nicht notwendig betrachtet werden. Zum Beispiel Datenmüll. Er sammelt sich im Handy, im Laptop oder dem Computer. Informationen, die wir nicht (mehr) benötigen, Fotos, die wir irgendwann gemacht haben und nicht mehr ansehen. Ein Post auf Social Media, schon lange vergessen.
Auch unser Gehirn speichert eine Vielzahl an Informationen – schätzungsweise 1 Petabyte (≈ 1 Mio. Gigabyte). Erfahrungen werden von klein auf in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Darüber denken wir zu oft nicht mehr nach und hinterfragen es auch nicht. Das führt dazu, dass wir Menschen in Kategorien einordnen – „Wir“ und „die“, uns fremdes und uns bekanntes. So nehmen wir uns selbst die Möglichkeit offen auf andere Menschen zuzugehen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und einander wert zu schätzen. Viel einfacher ist es sich schnell abzugrenzen.
Dieses „Othering“, sich von anderen zu distanzieren und jegliche Gemeinsamkeit von vornherein auszuschließen kann auch zur Körperlichkeit werden. Ausgrenzen hat auch Auswirkungen auf die Ausgrenzenden. Gereiztheit, Wut, Hass und weiteres wirken sich auch auf Psyche und Körper derjenigen aus, die andere Ausgrenzen. Wann habe ich das letzte mal mit einem Menschen gesprochen, der mir fremd erscheint.
Auch der andere Müll wird zur Körperlichkeit. Wir essen ihn. Jeden Tag eine Kreditkarte. Nicht am Stück. Aber in Form von Mikroplastik durch Getränke und Nahrung. Wir alle können Müll aufheben und in die Tonne werfen. Es ist gar nicht schwer. So landet zumindest weniger in uns. Es kann Gewohnheit werden. Schon ist die Welt ein wenig sauberer. Die Nachbarschaft schöner. Und wir ein klein wenig glücklich. Am 5. Juni ist Weltumwelttag – ein guter Tag um damit anzufangen.
Und jeder Tag ist die Möglichkeit einem anderen Menschen offen und freundlich zu begegnen. Ganz gleich, was erwidert wird.
Noch eines zum Synonym. Abfall ist ein älterer Begriff. Er entstammt aus dem religiösen Kontext – der Abfall vom Glauben. Und war somit von Beginn an negativ konnotiert.
Sämtliche Quellenangaben finden Sie hier.